Pünktlich zum Tag, an dem die zweite Kerze entzündet, die zweite Herdplatte zum Glühen gebracht wird, den ersten Schneefall mit Glühwein und Schneemännern feiert oder an dem man darüber nachdenkt, wie spießig sich die verhalten die genau das machen, erscheint der zweite Teil von Mirjams Sommermärchen. Die feierte schon in den frühen 80ern ihre persönliche Rebellion, als sie sich in der Hausbesetzer-Szene, in der sie sich herumtrieb, mit Verbesserungsvorschlägen zur Erhaltung der baulichen Substanz unbeliebt machte. Sie trug drei Strumpfhosen übereinander, weil sie in ihren spitzen Schnallenschuhen fror, besuchte in London und Florenz Konzerte von Siouxsie & The Banshees und Killing Joke und interessierte sich auch in Paris nicht für touristengerechte Kultur, sondern für den historischen Friedhof Père Lachaise.
Doch ein Leben für die alternative Szene, die Musik und ihre Leidenschaften erschienen ihr zunehmend ziellos. „Ja, der Zorn, für den ich keine Ausdrucksform fand, spiegelte sich in der Musik und es half mir, sie zu hören, aber die Verweigerung von allem war nicht meine Zielvorstellung. “ Sie traf sich mit anderen Leute, als den Punks & Hausbesetzern, zog in ein anderes Ende der Stadt, fand eine berufliche Heimat und gründete eine Familie mit Kind und Kegel. Als sie ihr Chef 2016 um die Urlaubswünsche für das kommende Jahr bat, zog sie die organisatorische Reißleine und plante ihren Urlaub nicht um ihre Kinder herum, sondern für sich selbst. Den Rest dieser Karriere kennen viele Gruftis. Du kannst Dich eben nicht selbst hinters Licht führen. Mirjam schreibt dazu: „Seither höre ich wieder Musik aus dem Gruftreich, ziehe komische schwarze Sachen an und gehe tanzen. Wie ich es so lange ohne ausgehalten habe ist erklärlich, aber nicht klar.“
Und so erfährt ihre Geschichte, die sie mir Ende November zuschickte, die wohlverdiente Fortsetzung, die mit ihren selbst gezeichneten Bildern zu einer spannenden Alternative im Einheitsbrei adventlicher Vorfreude mutieren könnte.
Kein Sommermärchen für Mirjam (Teil 2)
Die Nacht war jung – gerade mal 1h und das Naheliegendste wäre gewesen, ins Kraasmeyer zu fahren, doch ich entschied mich dagegen. So dünnhäutig und reizbar wie ich war, wäre es ziemlich dämlich gewesen, mich in einen Laden zu setzen, in dem mich unter Garantie irgendwer kannte und angesprochen hätte. Mir ging ja schon das Hupen eines Autos auf die Nerven, das gedämpft aus einer Nebenstraße herüberklang und nichts mit mir zu tun hatte. Ich entschied mich, zum Haus zurückzukehren. Wenn ich zu Fuß ging, statt die Bahn zu nehmen, hätte ich die Bewegung, die ich mir vom Tanzen versprochen hatte und frische Luft konnte auch nicht schaden. Zunächst jedoch ging ich zur Tankstelle an der Kreuzung, wo ich eine Literflasche Apfelschorle und eine Dose Erdnüsse als Wegzehrung erstand.
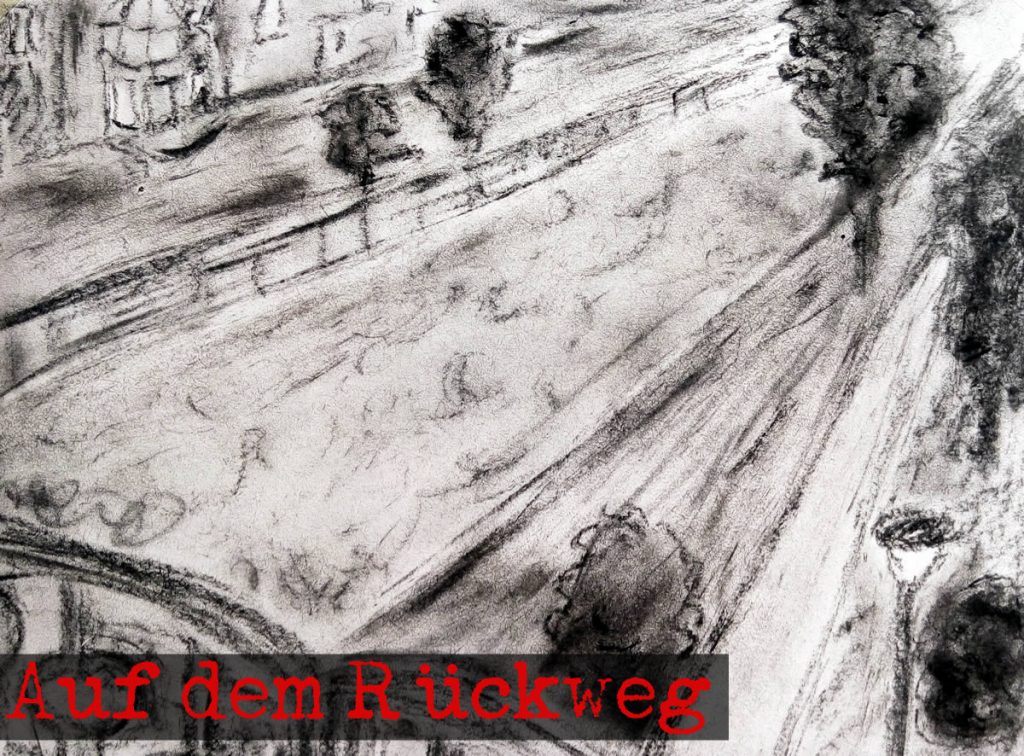
Musik: Picnic – From Korea to Korelia
Als ich beim Haus anlangte, war ich so müde gelatscht, dass ich mir eine reelle Chance auf etwas Schlaf in meinem Dachkabäuschen ausrechnete. In den Umhang gewickelt und mit meinem Büdel als Kopfkissen schlief ich dann tatsächlich. Nicht übermäßig bequem und dementsprechend unruhig, aber mehr hatte ich von dem Bretterdeckel, auf dem ich lag, auch nicht erwartet. Umso erstaunter war ich daher, dass es bereits nach acht war, als ich am Morgen erwachte. Sif würde wieder im Hause sein. Ob er sich schon hingelegt hatte? Wohl nicht.
Ich streifte die Schuhe nur über, ohne sie zu schnüren, klemmte meine Siebensachen unter den Arm und schlappte die Treppe hinunter. Dort klopfte ich wie üblich, statt zu klingeln. Für die Klingel fühlte ich mich nicht offiziell genug. Gähnend kreiste ich mit der linken Schulter, um die Steifigkeit aus dem Nacken zu bekommen, während ich auf eine Reaktion wartete. Sollte ich erneut klopfen? Noch bevor ich mich dazu entschließen konnte, hatte er die Tür geöffnet. Einen Moment musterte er mich, die Klinke noch in der Hand. „Du stinkst.“, waren dann seine Worte der Begrüßung.
War das fair? War das nett? War das nötig? Wusste ich schließlich selber.
Andererseits: Hatte ich wirklich erwartet, dass er mich trösten und begöschen 1 würde?
Selber schuld. „Du mich auch – Arschloch!“, ranzte ich zurück und drängelte mich an ihm vorbei in den Flur. Im Gehen streifte ich die Schuhe von den Füßen, schubste sie unter die Garderobe und ging mit Sack und Pack ins Zimmer, wo ich die Sachen vor, und mich auf meinen Sessel plumpsen ließ. Mit geschlossenen Augen saß ich dort, hörte zu, wie er die Tür verriegelte, mit irgendetwas in der Küche herumklöterte und anschließend ins Badezimmer ging. Auch als er auf seinem Weg zum Schlafzimmer an mir vorbeikam, ließ ich sie geschlossen. Sif dort im Bett zu wissen, war eine ziemlich verlockende Vorstellung, aber zum einen hätte er es mir nicht durchgehen lassen, mich jetzt bei ihm zu verkriechen und zum anderen bockte ich gerade. Arschloch. Genau wie ich gesagt hatte. Ich würde schon noch duschen. Aber nicht jetzt.
Wo war ich stehengeblieben? Bei diesem Typen in meinem Herzraum, der etwas wollte, wovon ich im Begriff gewesen war zu fragen, was.
Ich verdrehte die Augen und stand auf. Aus irgendeinem Grund hatte ich den Verdacht, dass sich hinter dieser Szene ein ziemlicher Klopfer verbarg.
Egal ob, oder wie – nicht ohne Wasser. Also trank ich am Küchenwasserhahn. Ausgiebig, bis ich mich fühlte, wie ein Vorratssack. Wieder auf meinem Sessel angekommen, breitete ich mir den Umhang als Decke über und schloss erneut die Augen. Als hätte er nur darauf gewartet, stand der Mann wieder da.
Feindselig starrte ich ihn an – das konnte nichts Nettes abgeben hier – nicht so, wie es sich anfühlte.

Musik: Bauhaus – Hollow Hills
Ein unsichtbarer Berg aufgestauter Emotionen, Verflechtungen und uneingelöster Versprechen drückt mir aus seinem Bild entgegen. Familie. Ein Vertreter meiner Ahnenlinie. Entnervt stöhnte ich auf – nur zu gern würde ich mich drücken, aber davon würde nichts besser werden und zudem konnte ich gewiss sein, dass Sif mich damit piesacken würde.
Ich atmete tief durch und versuchte die Bereitschaft zu finden, mich auf den Mann und das Thema, das er mitbrachte, einzulassen. Noch war sie nicht da. Mit jedem Atemzug entließ ich mehr und mehr der Ablehnung, in die ich mich eingekapselt hatte und dann war es soweit, war ich emotionslos und offen genug, dass er loslegte.
Ohne Bewegung des Bildes überschütten mich Kaskaden aus Zorn & Vorwurf, Anschuldigung aller Art, Hohn, Spott & Verachtung, Drohung und die Verurteilung dafür, nicht zu genügen. Eine Weile kann ich diese Flut an Niedermache unbeteiligt strömen lassen. Bis ich sie zu fühlen beginne und mich darin wiederfinde. Aufblitzender Schmerz, eine Pein, die alle Schichten meines Wesens durchzieht, begleitet einzelne Bilder, die aus dem Strom der Gefühlsbotschaften hervorleuchten: Die Lähmung und Unfähigkeit, mir mein Spielzeug wiederzuholen, oder auch nur laut zu protestieren, wenn andere Kinder mir etwas wegnehmen und die Schmach, dies bewusst zu erleben, ohne etwas daran ändern zu können.
Die Angst, auch nur einen einzigen Fehler zu machen, in der Gewissheit, damit die mir gewährte Chance zu vertun.
Es reicht mir, und ich trete ihm entgegen. Diese zwei Muster zogen sich durch mein ganzes bisheriges Leben und jetzt will ich sie nicht aus dem Blick verlieren, wenn ich sie schon so schmerzhaft vorgeführt bekomme.
Er hält inne, wartet ab und ich suche nach einem Ansatz, dies Thema anzufassen einer Absicht, oder Vorgehensweise.
Je mehr ich dies versuche, desto verschwommener fühle ich mich, und genau der Faden, den ich nicht zu verlieren beabsichtige, beginnt sich zu einer grau-nebulösen Masse zu verfilzen und ich dämmere weg. In einem Moment, in dem der Nebel heller wurde erfasse ich die Aussage: ‚Ich bin einzigartig‘, sie hatte keinen Gefühlsgehalt und ich fand sie selbstverständlich, weder neu, noch besonders hilfreich. Ich dämmerte weiter, bis ein allmählich zunehmendes, eckig unbequemes Körpergefühl mich weckte.
Als ich mich aus dem Sessel hochstemmte, um ins Bad zu gehen, wäre ich beinahe gestürzt.
Was war das denn bitte?
Als hätte jemand das Alter an sich, mit all seinen Gebrechen in meinen Körper entleert, schmerzte jedes meiner Gelenke. Unbeholfen staksig und vornübergebeugt tapste ich in Richtung Flur, wobei ich versuchte mich aufzurichten und zu recken, um ein wenig mehr Geschmeidigkeit in meine Bewegungen zu bekommen. Im Türrahmen stützte ich mich ab und pausierte.

Duschen wollte ich auf jeden Fall – vielleicht würde es ja sogar helfen, diesen Anfall schmerzhafter Steifigkeit loszuwerden, aber große Hoffnung darauf machte ich mir in diesen Moment nicht. Das fühlte sich ziemlich hartnäckig an.
So stellte ich mich dann unter die Dusche und fühlte den dünnen Fäden warmen Wassers nach, die an mir herabrannen. Es tat wirklich gut, und nachdem ich mich eine Weile so stehend, entschlossen gegen Schmerz und Steifigkeit angehend, gereckt und gedreht, gedehnt und gebogen hatte, ließ beides soweit nach, dass ich erleichtert aufseufzte und das Wasser ausdrehte.
Mist! An ein Handtuch hatte ich nicht gedacht.
Ich entriegelte das Fenster, hakte es halb geöffnet fest und begann mich mit Sifs abzutrocknen. Natürlich war es völlig Wurst wer welches benutzte, solange ich daran dachte, ihm ein frisches Exemplar hinzuhängen, aber auf eine bissige Bemerkung über kopfloses Herumagieren konnte ich mich so natürlich gefasst machen. Zuletzt wickelte ich es mir zum Rock um, raffte meine Anziehsachen zusammen und machte mich auf den Weg zum Wäscheschrank im Schlafzimmer.
Am Fußende des Bettes blieb ich stehen und betrachtete den Schlafenden. Wer ihn nicht kannte, hätte ihn für tot halten können. Mehr erstarrt als entspannt lag er da, mit einem abweisenden Ausdruck im Gesicht. Die Haut straffte über den Wangenknochen und die geöffneten Lippen gaben die Zähne frei. Große, starke Zähne, die das Knöcherne seines Wesens betonten, und von denen ausgehend ich den Schädel sah, das ganze Skelett, dem er so widerwillig diese Hülle aus fahler Haut, dicken Sehnen und strähnigen Muskeln übergezogen hatte, um es bewegen und dies Leben damit führen zu können.
Der Eindruck verwehte und ich legte meine Klamotten auf die Truhe, ging hinüber zum Wäscheschrank, um die Handtücher zu holen und beeilte mich, sie ins Bad zu bringen, da mir kalt zu werden begann.
Die Decke fest um die Schultern gezogen, lag ich dann auf der Seite und starrte vor mich hin, bis meine Lider sich senkten…
Im rechten Daumengrundgelenk, das am übelsten schmerzte, sehe ich eine Frau. Sie ist stämmig und sie steht fest auf dem Boden. Nicht mehr jung, sondern so, als wären ihre ältesten Kinder bereits im Jungmannalter, und sie die Vorsteherin eines großen, wohlhabenden Haushaltes. Einen nordischen Eindruck macht sie – schlicht, warm und sauber gekleidet in einen rostbraunen wollenen Rock und ein ebensolches Schultertuch über einem grünen Oberteil. Sie spricht, ohne dass ich sie hören kann und steht einige Meter vor einer großen Gruppe schweigender Frauen, die hinter ihr gesichtslos und einheitlich wirken. Abhängige? Untergebene? Nein. Schicksalsgenossinnen. Frauen gleicher Stellung, deren Anführerin, oder Fürsprecherin sie ist.

Noch immer höre ich nicht, was sie sagt, weiß nicht, worum es geht und an wen sie sich wendet, denn sie spricht nicht mit mir, sondern in meine Richtung, zu jemandem, der dort auch ist.
Dafür erkenne ich jetzt, was sie in der Rechten hält. Ein Stab ist es. Hellgeschnitztes Holz mit einem Kreuz im Ring als Ornament am oberen Ende, das sie um Haupteslänge überragt. Sie handhabt ihn souverän, obwohl es nicht ihrer ist. Er gehört ihrem Mann, dem Sippenführer, und schon oft ist sie seine Vertreterin gewesen, wenn er auf Reisen war. Jetzt ist er tot. Auch die Frauen hinter ihr sind Witwen, und sie spricht mit dem Anführer der Sieger, der Belagerer vor deren Aufbruch. Sie will erwirken, dass sie bleiben können. Ausgeplündert, allein, in den Brandruinen ihres Dorfes, nur bleiben. Doch so, wie ich ihre Worte nicht hören kann, wird sie nicht erhört. Als das Bild verwäscht, weiß ich, dass sie allesamt erschlagen oder verschleppt wurden.
Müsste ich nicht Trauer spüren? Wut, Zorn, Verzweiflung, Empörung? Irgendetwas? Doch in mir herrscht stumpfe Leere. Eine kompakte, reglose Gefühllosigkeit, die nicht einmal Resignation ist, denn diese setzt Hoffnungslosigkeit voraus, in die hinein sich ergeben werden kann, doch nicht einmal diese spüre ich.
Einzelnachweise
- Begöschen: beschwichtigen, beruhigen, besänftigen, umschmeicheln, betüdeln[↩]
Wizard of Goth – sanft, diplomatisch, optimistisch! Der perfekte Moderator. Außerdem großer “Depeche Mode”-Fan und überzeugter Pikes-Träger. Beschäftigt sich eigentlich mit allen Facetten der schwarzen Szene, mögen sie auch noch so absurd erscheinen. Er interessiert sich für allen Formen von Jugend- und Subkultur. Heiße Eisen sind seine Leidenschaft und als Ideen-Finder hat er immer neue Sachen im Kopf.



Ich weiß nicht, wieso mir diese Geschichte damals entgangen ist. Ich habe gestern die ersten zwei Teile gelesen, heute nochmals einige Passagen. Ich bin beeindruckt von der authentischen und präzisen Ausdrucksweise. Ich konnte dieses Jahr Mirjam kennenlernen. Sie ist einzigartig, ihre Sprache auch. Ich erkenne sie in dieser Geschichte.
Die Geschichte wirkte so intensiv nach dem Lesen, so dass ich sehr interessante Träume hatte. Mirjam, ich freue mich sehr darüber, dass ich Dich kennengelernt habe. Du bist einzigartig.